Die Preisträger des artig Kunstpreis 2016: Geister, Elefanten & bärtige Mädchen
Merlin Ortner, Elsa Nietmann & Nils Franke ausgezeichnet – Preis verdoppelt
 Genauso wie es sein soll: Applaus von Künstlern für Künstler im vollen Haus – so geschehen bei der Vernissage der Ausstellung zum artig Kunstpreis 2016 mit den vielen, vielen Gästen und Künstlern aus Nah und Fern, die das Kunstreich fast zum Platzen brachten. Danke an alle, die da waren an diesem wundervollen Abend! (hier geht’s zum Fotoblog →)
Genauso wie es sein soll: Applaus von Künstlern für Künstler im vollen Haus – so geschehen bei der Vernissage der Ausstellung zum artig Kunstpreis 2016 mit den vielen, vielen Gästen und Künstlern aus Nah und Fern, die das Kunstreich fast zum Platzen brachten. Danke an alle, die da waren an diesem wundervollen Abend! (hier geht’s zum Fotoblog →)
Und nun sind sie raus, die drei Preisträger sowie die versprochene Überraschung: Auf stolze 2.000 € (statt wie ausgeschrieben 1.000 €) haben wir den artig Kunstpreis 2016 verdoppelt und den extraartig-Sonderpreis der Jury auf 700 € (statt 500 €) erhöht. Dazu haben wir mit einer Einladung zu einer kostenfreien Ausstellung im Kunstreich eine zusätzliche dritte Auszeichnung vergeben (vorher gar nicht ausgeschrieben). Nach der überwältigenden Zahl von über 400 einreichenden Künstlern haben wir gerne neu gerechnet.
Auch der Publikumspreis, über den die Besucher bis zur Finissage am 8. Mai 2016 abstimmen, ist gestiegen. Die Brauerei Härle, die diesen Preis stiftet, erhöhte ebenfalls auf 700 € (von 500 €).
Jetzt aber zu den ausgezeichneten Werken und den Texten der Jury, die auch im großen Katalog zur Ausstellung (hier online durchblättern →) erschienen sind:
Ein Bild wie ein Roman
artig Kunstpreis 2016 für Merlin Ortner aus Teltow mit “Jules”
 » Es sind diese Bilder, die uns nicht nur kurz ins Auge stechen, sondern auch nach Tagen nicht loslassen und locken: Komm, ich erzähl Dir eine Geschichte, und dann erzählst Du mir eine. Bilder, die uns mit Freude rätseln lassen und auch dann keineswegs enttäuschen, wenn sie nicht alle ihre Geheimnisse preisgeben.
» Es sind diese Bilder, die uns nicht nur kurz ins Auge stechen, sondern auch nach Tagen nicht loslassen und locken: Komm, ich erzähl Dir eine Geschichte, und dann erzählst Du mir eine. Bilder, die uns mit Freude rätseln lassen und auch dann keineswegs enttäuschen, wenn sie nicht alle ihre Geheimnisse preisgeben.
Mit einer originalen Boxkamera von Kodak, einer „Brownie“ aus dem Jahr 1905, malt Merlin Ortner Bilder – und vielmehr: Er inszeniert und komprimiert einen ganzen Film auf einen einzigen Moment und schreibt zugleich einen Roman. Mindestens einen, denn bei den Betrachtern ruft seine Fotografie „Jules“ je nach deren persönlichen Geschichte unterschiedliche Reaktionen hervor: Der eine findet sich im männlichen Hauptdarsteller wieder, auch wenn der vor Hunderten von Jahren gelebt haben muss, verlassen und verloren, allein, fast hilflos bis autistisch in sich gekehrt. Der andere sieht einen bourgeoisen Jules, den es wachzurütteln gilt, bevor das dekadente Leben den Bach runter geht; er würde am liebsten in das Bild springen und ihn anstelle der geisterhaften Braut schütteln. Oder: Sie entdeckt sich selbst als jene junge Frau, die damals viel für ihn gegeben hätte. Doch er sah sie nicht.
 Mit der Verdichtung auf ein einziges Bild ist‘s aber nicht genug: Gleichsam kinematografisch packt Merlin Ortner die fein komponierte Szenerie in einen Leuchtkasten in der Größe eines üblichen Bildschirms. Durch diesen anachronistischen Rückgriff sitzt der Betrachter wie vor einem stillstehenden Video, einem eingefrorenem Monitor, auf dem heutzutage sonst so Vieles und Belangloses auf- und wieder wegblitzt. Mit Ortners analoger Langsamkeit beschenkt, stehen wir beunruhigend ruhig inmitten einer schnelllebigen Zeit. Eine Zeit, in der fast jedes Telefon mit einer Videokamera ausgestattet ist und auf Youtube jede Minute mehrere hundert Stunden Filmmaterial hochgeladen werden.
Mit der Verdichtung auf ein einziges Bild ist‘s aber nicht genug: Gleichsam kinematografisch packt Merlin Ortner die fein komponierte Szenerie in einen Leuchtkasten in der Größe eines üblichen Bildschirms. Durch diesen anachronistischen Rückgriff sitzt der Betrachter wie vor einem stillstehenden Video, einem eingefrorenem Monitor, auf dem heutzutage sonst so Vieles und Belangloses auf- und wieder wegblitzt. Mit Ortners analoger Langsamkeit beschenkt, stehen wir beunruhigend ruhig inmitten einer schnelllebigen Zeit. Eine Zeit, in der fast jedes Telefon mit einer Videokamera ausgestattet ist und auf Youtube jede Minute mehrere hundert Stunden Filmmaterial hochgeladen werden.
In der ruhenden Mitte zwischen klassischer Malerei und moderner Videokunst steht im besten wie im logischsten Falle einer wie Merlin Ortner: Sein Studium an der Hochschule Berlin-Weißensee hat er 2013 bei Friederike Feldmann, Professorin für Malerei, abgeschlossen. Heute arbeitet er als Künstler sowie als Production Designer bzw. Szenenbildner für Filmproduktionen. Aus dieser Erfahrung weiß er, wie nah Wirklichkeit und Fiktion beieinander liegen. Wir können beiden nicht trauen, sagt Ortner: der Wahrnehmung nicht, und der Fotografie nicht, da wir zu viel über deren Manipulation wissen.
Dass Geschichtenerzähler aber nicht der Wahrheit – und wessen Wahrheit überhaupt? – verpflichtet sind, wissen wir wie er. So lassen wir uns gerne einwickeln von seiner wie unserer eigenen Phantasie.
 „Jules“ stammt aus der mehrteiligen Fotoserie „Der Geist von Görlitz”, die Ortner 2015 konzipierte und in Jahrhunderte alten Häusern von Görlitz inszenierte. Hier machte er einen Ort zur Bühne, dessen historische Innenstadt im Zweiten Weltkrieg fast völlig verschont blieb und mit über 4.000 Baudenkmalen als das größte zusammenhängende Flächendenkmal Deutschlands gilt.
„Jules“ stammt aus der mehrteiligen Fotoserie „Der Geist von Görlitz”, die Ortner 2015 konzipierte und in Jahrhunderte alten Häusern von Görlitz inszenierte. Hier machte er einen Ort zur Bühne, dessen historische Innenstadt im Zweiten Weltkrieg fast völlig verschont blieb und mit über 4.000 Baudenkmalen als das größte zusammenhängende Flächendenkmal Deutschlands gilt.
Der „Geist“ sei in seinem Kopf entstanden, als er dort in einem Haus aus dem 14. Jahrhundert wohnte, erzählt er: „Ich war der festen Überzeugung, dass ich die Geister, die überall in der Stadt zu finden sind, fotografisch festhalten muss.“ Die mit der „Brownie“ und ihren nur drei Blenden eingefangenen Rollfilm-Fotos bearbeitet er nie in Photoshop oder ähnlichem.
Ob wir‘s glauben oder nicht – dass diese Geschichte wahr sein muss, zeigen die Bilder, die er aus Görlitz mitgebracht hat.
Apropos Geschichte: Während in den 50er Jahren die Fotografie erst langsam salon- und museumsfähig wurde, ab Ende der 70er dann Künstler wie Jeff Wall konsequent mit großformatigen Leuchtkästen aus der Werbeindustrie arbeiteten, stand in den Wohnzimmern vielleicht ein Fernsehgerät und auf den Schreibtischen eine Schreibmaschine. Heute ist es umgekehrt: Wir sind im Büro wie zuhause von Monitoren und mobilen Bildschirmen umgeben.
Umso mutiger und konsequenter ist Ortners inhaltlicher wie formaler Kunstkniff, nebst der Box-Kamera auf inzwischen altmodisch wirkende, bilderbuchgroße Leuchtkästen aus Glas und Holz zurückzugreifen und für sich als die beste Form der Vermittlung zu entdecken. Dies beeindruckte die Jury ebenso wie seine fotografische Herangehensweise und seine grandiose Erzählkunst.
Wir gratulieren Merlin Ortner aus Teltow herzlich zum artig Kunstpreis 2016! «
Im Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht
extraartig-Sonderpreis der Jury für Elsa Nietmann aus München mit “Elefantenherde”
 » Staubtrocken. Durst steckt in der Kehle. Man fühlt sich versetzt in die dürre, afrikanische Wüste – auf eine der langen Elefantenstraßen. Die größten noch lebenden Landtiere beschreiten diese Pfade immer wieder auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Doch ihr Lebensraum schrumpft beständig, und so schrumpfen sie selbst.
» Staubtrocken. Durst steckt in der Kehle. Man fühlt sich versetzt in die dürre, afrikanische Wüste – auf eine der langen Elefantenstraßen. Die größten noch lebenden Landtiere beschreiten diese Pfade immer wieder auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Doch ihr Lebensraum schrumpft beständig, und so schrumpfen sie selbst.
Die Bildhauerin Elsa Nietmann aus München hat die Herde naturgetreu angeordnet: Die jungen Kälber gehen flankiert von den Mutterkühen. Vorne weg schreitet die Älteste als Leitkuh. Alles hat seine Ordnung. Eine Ordnung, die allerdings ebenso zerfällt wie die Tiere selbst auf ihrem Weg. Führt er zum Wasser? Führt er zur grüneren Savanne? Wie lange noch?
Zerfall und Fragilität sind hier die großen präsenten Themen – und das obwohl die Künstlerin mit harten, anorganischen, kaum vergänglichen Materialien arbeitet: Beton und Eisen.
 Sie erzeugt durch Aussparen den Eindruck des Zerbrechlichen und die Anmutung einer aus der Balance geratenen Welt. Sie lässt weg bis an die Grenze, bis kurz vor den Punkt, an dem die Tiere unkenntlich werden würden. Sie legt dürre Gerippe offen, die nur sehr langsam weiterziehen können, da die Schritte mit den müden, schweren Beinen immer mehr Kraft kosten. Sie zeigt sehr dünnhäutige Dickhäuter.
Sie erzeugt durch Aussparen den Eindruck des Zerbrechlichen und die Anmutung einer aus der Balance geratenen Welt. Sie lässt weg bis an die Grenze, bis kurz vor den Punkt, an dem die Tiere unkenntlich werden würden. Sie legt dürre Gerippe offen, die nur sehr langsam weiterziehen können, da die Schritte mit den müden, schweren Beinen immer mehr Kraft kosten. Sie zeigt sehr dünnhäutige Dickhäuter.
Die Arbeit entwickelt eine unglaubliche Schlagkraft und spricht uns auf emotionaler wie rationaler Ebene an. Denn wir wissen, dass der Mensch dem Elefanten nicht gut tut. Er jagt ihn wegen seiner wertvollen Stoßzähne und raubt seinen Lebensraum. Wir wissen ebenso, dass das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen Tier und Mensch längst aus dem Lot geraten ist. Doch selten trifft es uns in der Kunst so eindringlich, direkt und zugleich subtil wie mit der „Elefantenherde.“
Der Boden, auf dem sie gehen, ist auch ausgedörrt, rissig – löst sich auf, bietet kaum noch Lebensgrundlage. Damit endet der Kreislauf von Leben und Sterben. Kein fruchtbarer Boden, kein Leben. So wie die Erde selbst erodiert, so schwindet die Welt wie wir sie kennen. Die Elefanten werden zur Zukunftsprojektion für uns selbst: Wann werden wir Wasser und Nahrung suchen?
Die überzeugende und berührende Intensität des Werks entsteht aus genau der richtigen Balance zwischen angedeuteten und konkret ausgearbeiteten Formen, zwischen den schweren Materialien und der Durchlässigkeit des Ausgesparten. Dabei macht das Material auch die scheinbare Unausweichlichkeit des Weges deutlich. Er ist buchstäblich festbetoniert.
So ist sie nicht schön, die „Elefantenherde“. Dennoch ist sie schön anzusehen. Trotz aller Schwere entfaltet sie eine bemerkenswerte Ästhetik. So, dass die Tiere ihre Würde behalten.
Und so, dass ein Gedanke aus einer ganz anderen philosophischen Denkweise Platz bekommt: In Indien, wo ebenso noch Elefanten leben, gilt die Zerstörung als Grundlage für alles, was wird, als Teil des ewigen Zyklus. Aus jeder Zerstörung entsteht Neues. Dazu gaben die alten Inder dem Gott, der Hindernisse beseitigen und Glück bringen soll, eine ganz besondere Gestalt: den Elefanten. «
Zwischen Ekel und Faszination
Einladung zur Ausstellung im Kunstreich für Nils Franke aus Leipzig
 » Sie fesseln auf den ersten Blick, nicht nur ihre Blicke. Unmittelbar ziehen sie den Betrachter hinein in ihre Widersprüchlichkeiten. Sie lassen uns sofort beginnen, Lebensgeschichten um die portraitierten Gesichter zu spinnen und zu fragen: Was hat die alte Frau wirklich gegessen? Und ob die Mädels je eine Chance auf eine freie und ausgelassene Kindheit hatten? Wurde eine von ihnen später Lager-Aufseherin oder Mutterkreuz-Trägerin?
» Sie fesseln auf den ersten Blick, nicht nur ihre Blicke. Unmittelbar ziehen sie den Betrachter hinein in ihre Widersprüchlichkeiten. Sie lassen uns sofort beginnen, Lebensgeschichten um die portraitierten Gesichter zu spinnen und zu fragen: Was hat die alte Frau wirklich gegessen? Und ob die Mädels je eine Chance auf eine freie und ausgelassene Kindheit hatten? Wurde eine von ihnen später Lager-Aufseherin oder Mutterkreuz-Trägerin?
Es ist diese paradoxe Mischung aus anziehender, malerischer Schönheit und abstoßendem Ekel, die unsere Aufmerksamkeit im Nu erhascht – diese Mischung aus gruseliger Dramatik und neugieriger Faszination. Die spürbare Spannung zwischen Gut und Böse, den beiden Polen, die in uns allen liegen, wirkt direkt. Und Naivität und Frivolität sind auch dabei, fast etwas Anrüchiges und Abgründiges.
Damit landen wir wie eine Fliege im Netz des Malers Nils Franke aus Leipzig. Auf Flohmärkten sucht und findet der Meisterschüler von Prof. Peter Bömmels an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss 2015) seine Motive: alte, originale Portraitfotos aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, als Kameras für die Menschen nicht selten noch mystische Zauberkästen waren. Damals musste man für ein halbwegs scharfes Bild einerseits lange still sitzen.
Ein anderer Grund für die typisch steinern wirkenden Gesichter: Man sieht den Fotografierten auf solchen Aufnahmen auch die Skepsis gegenüber der noch unbekannten Technik an. Als ob sie Angst hätten, die Kamera würde direkt in ihre Seele blicken oder etwas entdecken, das nicht sein durfte in der biederen Gesellschaft, die von der in Kunst und Kultur längst durchgebrochenen Moderne noch nicht so viel mitbekommen hatte.
Genau diese Unsicherheit nimmt Nils Franke mit in seine meisterlich in Öl gemalten Werke. Er arbeitet das Ängstliche, das Zögerliche und das Kalte heraus. Dazu verfremdet er nur ganz wenig, lässt Details weg, betont sie deutlicher oder nimmt sie hinzu – und erreicht so eine emotionale Ambivalenz in seinen Bildern, die außergewöhnlich und außergewöhnlich stark ist.
 Die Bärte stehen den „Deutschen Mädels“ nicht schlecht. Die ästhetische Umwidmung baut genau diese Spannung auf, die es braucht, um Frankes Werken zusätzlich zur handwerklichen Perfektion eine tiefere Intention zu geben. So fühlen wir mit den Mädels und hoffen für sie, dass sie auch Mädchen sein durften und im BDM – den im totalitären Sinne der Nationalsozialisten aufgebauten „Bund Deutscher Mädel“ – nicht nur zu Kampf und Entbehrung für Volk und Vaterland erzogen wurden.
Die Bärte stehen den „Deutschen Mädels“ nicht schlecht. Die ästhetische Umwidmung baut genau diese Spannung auf, die es braucht, um Frankes Werken zusätzlich zur handwerklichen Perfektion eine tiefere Intention zu geben. So fühlen wir mit den Mädels und hoffen für sie, dass sie auch Mädchen sein durften und im BDM – den im totalitären Sinne der Nationalsozialisten aufgebauten „Bund Deutscher Mädel“ – nicht nur zu Kampf und Entbehrung für Volk und Vaterland erzogen wurden.
Man darf gespannt sein auf ihre Brüder von der HJ: Nils Franke hat die „Hübschen Jungs“ bereits im Kopf. Hoffentlich finden sie bis zu seiner aus dem Fonds des artig Kunstpreis 2016 gestifteten Ausstellung im Kunstreich den Weg auf die Leinwand. «
Katalog:
Ausstellung:
Mehr zur Ausstellung und den Künstlern →
Fotoalbum:
Die Vernissage im Fotoblog nacherleben →
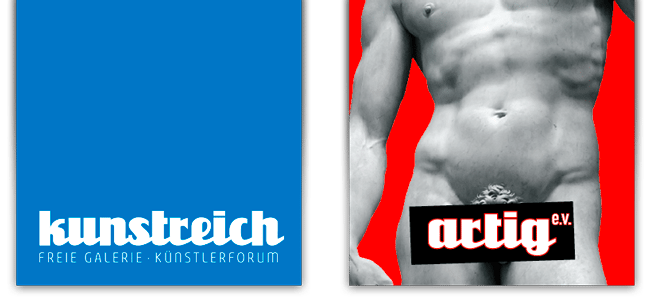





 Nils Franke
Nils Franke

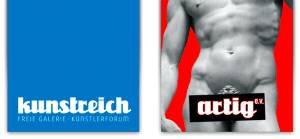


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!